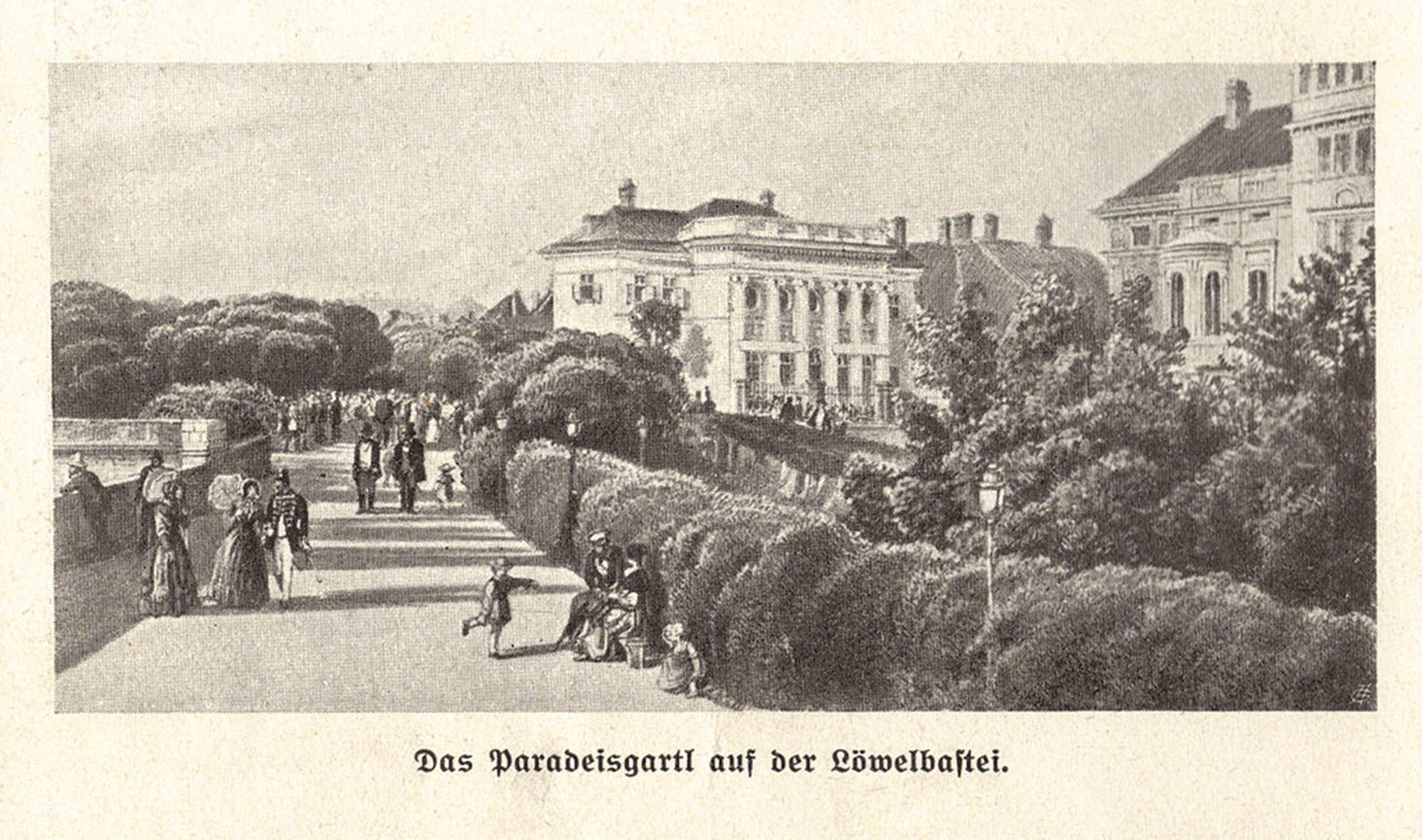Der „Wiener Polsterzipf“ ist eine traditionelle Mehlspeise. Sie begeistert nicht nur durch ihre charakteristische Dreiecksform, sondern auch durch ihren knusprigen Teig und ihre köstliche Füllung. Seit Jahrhunderten erfreut sich dieses Gebäck großer Beliebtheit. Als einfache, aber raffinierte Nachspeise oder als kulinarische Überraschung für den Adel.
Die eigentümliche Dreiecksform der Mehlspeise mit den Namen „Wiener Polsterzipf“ faszinierte zu jeder Zeit ihre Betrachter. Mürb- oder Blätterteig bildet die Grundlage bei der Herstellung dieser Köstlichkeit. Im rohen Zustand werden kleine oder größere „Rechtecke“ entweder mit dem Messer herausgeschnitten oder mit einer Backform herausgestanzt und zu Dreiecken zusammengeklappt. Diese werden in heißem Schmalz herausgebacken und danach mit einer Marmeladenart, entsprechend persönlicher Vorlieben gefüllt.
Wer den „Wiener Polsterzipf“ gewissermaßen „pur“ genießen will, der verzichtet auf jegliche Füllung. Dieses knusprige Dessert offenbart auch ohne Marmelade eine Gaumenfreude. In den Küchen der Adeligen waren die Meister mit Löffel und Topf immer angehalten, die hochherrschaftlichen Damen und Herren mit besonderen lukullischen Überraschungen zu verwöhnen. Ein berühmter Koch, Balthasar Staindl, der seine neuen Gerichte um die Mitte des 16. Jahrhunderts in deutschen und österreichischen Städten vorstellte, nannte die meist als Nachspeise servierte Gaumenfreude auch „Hasenohren“.
Das historische Rezept
Noch um die Mitte des 20. Jahrhunderts und Jahre danach wurde der Teig für die Speise noch selber hergestellt. 15 Dekagramm Weizenmehl, 3 Eidotter, 3 Dekagramm feinen Zucker, jeweils 1 Esslöffel Rum und Weißwein, sowie 4 Dekagramm Sauerrahm werden zu einem Teig verarbeitet. Danach wird der Teig ausgiebig geknetet. Erst dann erfolgen die bereits beschriebenen Arbeitsgänge, ehe die kleinen Dreiecke in einer Pfanne goldgelb gebraten werden. Zum Schluss werden sie mit Staubzucker bestreut und serviert. Wie gesagt mit oder Füllung, wie es gefällt. Obwohl man anmerken muss, dass sich Marillenmarmelade auch sehr gut als Füllung für „Polsterzipfe“ eignet.
Time Travel Tipp: Gemeinsames Backen könnte auch ein lustiges Motto sein, um Freunde zu treffen. Mit ihnen Omas Kochbuch durchblättern und die relativ einfache Süßspeise backen und danach ausgiebig genießen.
Hast du Lust auf weitere historische Dessert Rezepte? Dann probiere doch Äpfel im Schlafrock: hier geht´s zum Rezept!
Quellen:
https://de.wikipedia-org/wiki/Polsterzipf, 29.2.2024
Perlen der Wiener Küche von Franz Ruhm, Deutsche Buchgemeinschaft, Wien, 1950, Seiten: 151, 152